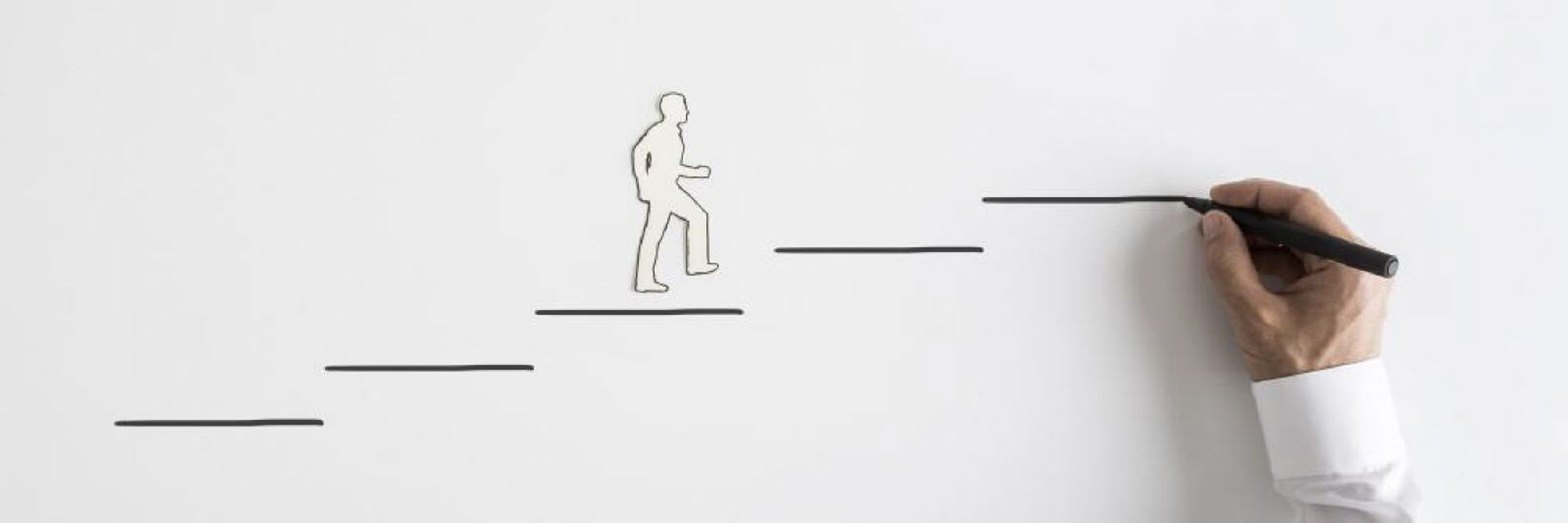Umgang mit nicht sichtbaren Behinderungen
Nicht sichtbare Behinderungen betreffen eine große Zahl der Menschen mit Behinderung. Viele Behinderungen entstehen erst im Laufe des Lebens, z.B. als Folge von Erkrankungen. Viele Betroffene haben selbst das verbreitete Bild im Kopf: Behinderung = Rollstuhlfahrer oder Kind mit Down-Syndrom. Sie sehen sich deshalb selbst nicht unbedingt als behindert an, sogar wenn sie Anspruch auf einen Schwerbehindertenausweis hätten.
Kommunikation ist der Schlüssel. Hier gibt es viele Fallstricke, hier misst sich Barrierefreiheit. Missverständnisse drohen von Seiten der Menschen mit unsichtbarer Behinderung wie auch von Seiten des nichtbehinderten Umfelds.
Viele Probleme entstehen, wenn Menschen mit ihrer unsichtbaren Behinderung von ihrem Umfeld und zum Teil selbst vom Gesundheitssystem nicht ernst genommen werden. Man sieht keine Behinderung, also kann es nicht so schlimm sein… Aber auch ungebetene, vorschnelle Ratschläge sind nicht hilfreich. Sie behindern ein positives Selbstbild und respektvolle, vertrauensvolle Beziehungen.
Für Menschen mit einer unsichtbaren Behinderung besteht das Dilemma, sich als behindert zu sehen und zu „outen“ oder lieber doch nicht?
Sie wollen oft nicht auffallen. Trotz Behinderung mitzuhalten und erfolgreich zu sein, kann selbstbewusst machen. Aber um den Preis von Stress, Überforderung, eingeschränkter Lebensqualität und eventuell Verschlimmerungen. Sich und seine Behinderung dauernd erklären zu müssen, kann stigmatisierend und sehr anstrengend sein.
www.aktion-mensch.de/dafuer-stehen-wir/was-ist-inklusion/unsichtbare-behinderung
In Deutschland leben ca. 80.000 Gehörlose und mindestens 14 Millionen Menschen mit einer Hörbehinderung bei steigenden Zahlen.
www.hoerbehindertenhilfe.de
Beispiel: Barrieren bei Hörbehinderung
Das Spektrum der Hörbehinderungen reicht von beginnender bis hochgradiger Schwerhörigkeit bis zur Gehörlosigkeit. Hörbehinderungen gehen mit Einschränkungen der Kommunikationsfähigkeit einher, die sich individuell unterschiedlich auswirken. So macht es große Unterschiede, ob die Hörbehinderung vor oder nach dem Spracherwerb eingetreten ist.
Schwerhörigkeit als häufigste Form dieser Sinnesbehinderung ist eine unsichtbare Behinderung, die oft von Außenstehenden entweder kaum wahrgenommen wird oder aber als anderes Extrem in Verbindung mit Alter und abnehmenden Denkfähigkeiten gebracht wird. Technische Hilfsmittel wie Hörgeräte oder Cochlea-Implantate sind oft sehr hilfreich, stellen aber in vielen Fällen das normale Hörvermögen nur eingeschränkt wieder her.
Technik kann nur das verstärken, was im Gehör noch ankommt. Es kann schwierig sein, hohe oder tiefe Stimmen zu hören und die Buchstaben zu dechiffrieren, die in der geschädigten Frequenz gesendet werden. Auch mit Hörgeräten ist Kommunikation für die betroffenen Menschen anstrengender als für Normalhörende. Oft muss ein Teil des Gesagten „zusammengereimt“ werden. Noch schwieriger wird es im Störschall. Öffentliche Räume und Treffpunkte wie Cafés und Restaurants sind oft akustisch schlecht aufgestellt. Hier wird Kommunikation für Menschen mit Hörbehinderung sehr anstrengend bis unmöglich.
Hörbehinderung ist eine nicht sichtbare Behinderung, die oft erst im Laufe des Lebens auftritt. Da sie häufig nicht so mitgedacht wird wie Mobilitätsbehinderungen, gibt es im Arbeitsalltag nur teilweise Hilfen durch Rücksichtnahme in der Kommunikation, Wahl der Besprechungsräume etc. Für die Menschen mit Hörbehinderung, die „trotzdem funktionieren“, hat das den Preis einer hohen Belastung.